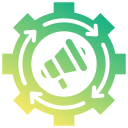Figurenarbeit mit ökologischer Tiefe
Anstelle heroischer Einzelkämpfer zeigen Hüterinnen, Hausmeister oder Gärtner kollektive Fürsorge. Sie koordinieren, reparieren, verhandeln und bleiben, wenn Kameras weiterziehen. Diese Figuren machen Pflege attraktiv und zeigen, dass Nachhaltigkeit aus kontinuierlicher, gemeinsamer Praxis entsteht.
Figurenarbeit mit ökologischer Tiefe
Ein Pilzgeflecht erinnert sich anders als ein Mensch; ein Sturm kennt andere Zeitskalen. Indem nichtmenschliche Erzähler eingesetzt werden, wird Empathie erweitert und das Verhältnis von Ursache und Wirkung neu verhandelt. Leserinnen verlassen gewohnte Bahnen und sehen Handlungen in größerem Zusammenhang.